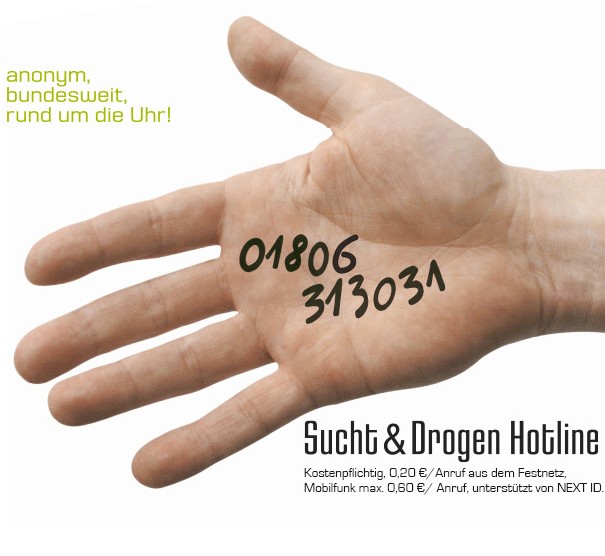COVID-19: Krisenbewältigung aus Sicht der Selbsthilfeorganisationen
Hierzu siehe auch Presse
„Lock-Down light“: Medizinisch sinnvolle und notwendige Präsenztreffen für Selbsthilfegruppen können stattfinden
Eva Gottstein (Beauftrage des Bayerischen Staatsministeriums für das Ehrenamt): "Wichtiges Signal an ehrenamtlicher Basis der Selbsthilfe"
Dezember 2020
Im Zuge der verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wur-den die Kontakte sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum abermals stark begrenzt, berufliche oder dienstliche Tätigkeiten sind aber davon ausgenommen. Doch wie verhält es sich mit Selbsthilfegruppen?
Nach erfolgtem Austausch von Selbsthilfeaktiven, Selbsthilfekontaktstellen und der SeKo Bayern mit der Staatsregierung ist nun klar, dass sich Selbsthilfegruppen weiterhin physisch, d.h. in Präsenz, treffen können, wenn es medizinisch sinnvoll und notwendig erscheint. Die allgemein gültigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind dabei natürlich zu berücksichtigen.
„Bayerns Selbsthilfegruppen, ganz gleich ob im sozialen oder im Gesundheitsbereich, sind extrem wichtig für viele Menschen in unserer Heimat. Als Ehrenamtsbeauftragte begrüße ich es sehr, dass sich nun zumindest ein Teil der ca. 11.000 Gruppen wieder treffen darf“, zeigt sich Eva Gottstein erfreut. Videokonferenzen seien nur bedingt dazu geeignet, Menschen in Extremsituationen zu helfen, davon ist die Beauftragte überzeugt. „Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in der schulischen Drogenberatung weiß ich, dass der unmittelbare Austausch von Angesicht zu Ange-sicht entscheidend für den Erfolg ist“, so die ehemalige Realschulleiterin.
Weitere Informationen sowie den Originallaut des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden Sie auf der Homepage der SeKo Bayern unter diesem Link.
SEKO Bayern
Selbsthilfe und Corona
Selbsthilfegruppen in Bayern dürfen sich treffen - allerdings unter strengen Auflagen
06.11.2020
Gemeinsam haben sich seit Beginn des Lockdown Light Selbsthilfeaktive, Selbsthilfekontaktstellen, Politik und wir von SeKo Bayern um die weitere Durchführung für Präsenztreffen für Selbsthilfegruppen bemüht.
Jetzt wurde eine Lösung gefunden: Selbsthilfegruppen dürfen sich auch bei Präsenztreffen sehen, wenn es medizinisch sinnvoll ist. Im Gespräch mit dem Staatssekretär wurde gestern geklärt, dass sich Selbsthilfegruppen auch ohne fachliche Leitung treffen können, wenn dies absolut notwendig ist. Dies gilt für alle Selbsthilfegruppen im Gesundheits- und Sozialbereich, wenn Suchtdruck, psychische Probleme oder der Austausch über chronisch somatische Erkrankungen/Behinderungen in Präsenztreffen so wichtig sind, dass dieser durch ein Onlinetreffen oder andere Möglichkeiten des Kontaktes nicht ersetzt werden kann.
Allerdings gibt es für das Durchführen strenge Auflagen wie Hygienekonzept, Einhaltung der Aha-Regeln und Maskenpflicht.
Hier der Originaltext des Schreibens vom 05.11.2020:
„Selbsthilfegruppen ergänzen das professionelle Versorgungssystem. Sie betonen die Eigenverantwortung und ermöglichen Teilhabe der Betroffenen und setzen sich auch mit der medizinischen Versorgung auseinander. Neben der fachlichen Beratung und Information bereichern sie die Versorgungslandschaft niedrigschwellig durch eine psychologische und soziale Komponente und setzen wertvolle Ressourcen für die Gesunderhaltung und Problembewältigung frei. Selbsthilfe-Verbände für z B. Menschen mit Behinderung, chronischen psychosozialen Krankheiten oder Suchterkrankungen bieten darüber hinaus Möglichkeiten der Begegnung und Vertretung der Anliegen und Interessen behinderter oder chronisch kranker Menschen. Selbsthilfe hat daher einen hohen gesundheitspolitischen Stellenwert. Sie zeichnet sich typischerweise durch den selbstbestimmten Austausch Betroffener sowie Angehöriger in Gruppen aus, um die persönliche Lebensqualität zu verbessern.
Online-Treffen der Selbsthilfegruppen sind immer zulässig. Nach dem Sinn und Zweck der 8. BayIfSMV können darüber hinaus auch absolut notwendige Präsenztreffen von Selbsthilfegruppen stattfinden. Die Durchführung als Präsenztreffen soll nur dann in der Gruppe erfolgen, wenn hierdurch ein gesundheitlicher oder körperlicher Erfolg zu erwarten ist, der umgekehrt bei der individuellen Betreuung ausbliebe, und die Durchführung medizinisch sinnvoll und notwendig ist.“
Zwischen allen Beteiligten ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Es besteht Maskenpflicht, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen, sowie bei Präsenzveranstaltungen am Platz. Der Veranstalter oder in sonstiger Weise für die (Selbst-)Organisation der Gruppe Verantwortliche hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Es ist auf geeignete Weise sicherzustellen, dass die Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist.“
Neue Impulse jetzt nutzen! – Welche notwendigen Konsequenzen wir aus den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie für eine wirkungsvolle Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe ziehen müssen
(Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V.)
Einleitung
Das differenzierte System der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe erfüllt auch in Krisensituationen die wichtigen Aufgaben der medizinischen und psychosozialen Versorgung, der Förderung der Teilhabe am beruflichen, sozialen und gesellschaftlichen Leben sowie der Entstigmatisierung von abhängigkeitsgefährdeten und -kranken Menschen und ihren Angehörigen und trägt somit zur Stabilisierung der sozialen Gemeinschaft bei.
Die Folgen der COVID-19-Pandemie und die ergriffenen bundesweiten und länderspezifischen Maßnahmen haben die Organisationen und Einrichtungen der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe mit außergewöhnlichen Herausforderungen konfrontiert. Sie haben nachhaltigen Einfluss auf die Sicherstellung der Versorgung abhängigkeitsgefährdeter und -kranker Menschen und ihrer Angehörigen, auf den Erhalt der Liquidität der Einrichtungen/Angebote und ihre Arbeitsfähigkeit. Um sowohl die Herausforderungen als auch die Konsequenzen praxisorientiert zu konkretisieren sowie Unterstützungsbedarfe zu formulieren, hat der Fachverband Drogen-und Suchthilfe e.V. (fdr) eine Online-Mitgliederbefragung1 durchgeführt. Die Befragung erfolgte im Zeitraum 10.-17.Juni 2020 und stellt somit eine Momentaufnahme dar. Die zentralen Ergebnisse werden im Folgenden beschrieben sowie daraus abgeleitet fdr Forderungen formuliert:
Auswertung der fdr+ Mitgliederbefragung zur Corona-Pandemie 2020
Aus den Rückmeldungen der bundesweiten Mitgliedseinrichtungen und –organisationen, welche sich meist in freier Trägerschaft befinden, konnten insgesamt 95 vollständig ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden. Die Hälfte der Organisationen/Einrichtungen hat ihren Arbeitsschwerpunkt in der ambulanten Suchthilfe; die andere Hälfte teilt sich in stationäre Einrichtungen, Suchtselbsthilfe, Behörden und Sonstige auf. Differenziert betrachtet konnten bzw. können die meisten spezifischen Angebote (N=683) sowohl während als auch (perspektivisch) nach der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden. Bedeutende Einschränkungen der Angebote (während des Lockdowns) sind jedoch in den Bereichen Selbsthilfe, Prävention, Suchtberatung im Betrieb und in der JVA, niedrigschwellige Hilfen sowie bei den Beschäftigungsprojekten zu verzeichnen. Diese liegen in den Kontaktbeschränkungen begründet, nach denen externe Angebote (z.B. in Schulen und Betrieben) und Gruppenveranstaltungen unterbunden wurden. Nur wenige Angebote (10) können (perspektivisch) nach Corona nicht wieder vorgehalten bzw. aufgebaut werden. 90% der Einrichtungen/ Organisationen bestätigen eine Mehrbelastung des Personals durch die Corona-Pandemie, deren Ursache im Mehraufwand durch Schutzmaßnahmen, in veränderten Kommunikationsmodi/Kontaktaufnahmen und in der eigenen psychischen Belastung sowie der der Klientel (z.B. durch Isolation) liegt. Die Auswirkungen dieser Mehrbelastung sind vielfältig und reichen von Mehrarbeit/verdichteten Arbeitszeiten und erhöhten Krankenständen bis hin zu gestiegenem Spannungspotential zwischen den Mitarbeiter*innen (untereinander) und mit den Klient*innen.
Auswertung Mitgliederbefragung
Die Angaben zur Auslastung der einzelnen Angebote/ Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie sind sehr unterschiedlich und vermutlich regional begründet. Dennoch verzeichnen 43% der Angebote/ Einrichtungen einen signifikanten Rückgang der Auslastung, insbesondere im stationären Reha-Bereich, der Eingliederungshilfe, den Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen, der Selbsthilfe und der Prävention. Zusätzlich kam es zu Schließungen im Bereich der Kontakt- und Begegnungsstätten. Der Auslastungsrückgang wird vorrangig mit rechtlichen Rahmenbedingungen wie behördlichen Belegungsstopps, einzuhaltenden Hygienemaßnahmen/Abstandsregelungen/Notprogrammen und Quarantänemaßnahmen sowie den Verordnungen zum Freihalten von Kapazitäten für Notfallversorgung aber auch mit sinkender Nachfrage, fehlendem Personal durch Krankheit oder Notkinderbetreuung und sonstigem begründet. Auch auf die Gruppenangebote der Ambulanten Reha Sucht (ARS), der Nachsorge und der Suchtberatung hatten insbesondere die umzusetzenden Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen tiefgreifende Auswirkungen. So mussten Gruppengrößen reduziert bzw. entsprechend größere Räumlichkeiten organisiert und angemietet, auf digitale Formate ausgewichen oder vermehrt Einzelberatung durchgeführt werden, was wiederum erhebliche Mehrkosten (Personal, Ausstattung etc.) nach sich zog/zieht. 70% der Einrichtungen/Organisationen geben an, dass sich ihre Liquidität perspektivisch verringern wird, ursächlich aufgrund der Gefährdung der Umsetzung der Angebote (z.B. aufgrund von Kontaktbeschränkungen, Einnahmeeinbußen), bedeutender Umsatzeinbußen (über 10 %) sowie notwendiger Mehr-Investitionen (bauliche Maßnahmen, zusätzliche Räumlichkeiten, (technische) Ausstattung, Schutzausrüstung, Personal). Die Organisationen und Einrichtungen sind im Umgang mit Herausforderungen erprobt und haben auch während der Corona-Pandemie differenzierte Maßnahmen ergriffen, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, die Zielgruppe (situativ) auch weiterhin zu erreichen und die Hygienevorschriften einzuhalten. Die Kosten für den deutlichen Mehraufwand wurden dabei jedoch nicht refinanziert. U.a. wurden flexible Beratungszeiten (auch Wochenend- und Feiertagsangebote) eingeführt, Konzeptanpassungen vorgenommen, neue Angebote (mit neuen/anderen Themen) gestaltet, neue Wege zur besseren Erreichbarkeit der Zielgruppe gegangen, Mitarbeiter*innen themenspezifisch neu geschult, Kooperationen ausgebaut, finanzielle Unterstützungsangebote akquiriert, die notwendig gewordene Hard- und Software-Ausstattung ausgebaut und entsprechende Beratung in Anspruch genommen, technische Dienstleistungen (web-services) sowie Telefonische Beratung, Chat-Angebote, Video-Angebote und andere digitale Angebote entwickelt und eingesetzt, Schutzmaßnahmen (z.B. Desinfektionsmittel, Handschuhe) und andere hygienische Maßnahmen getroffen, Unterstützung/ Beratung/ Behandlung unter Einsatz von Mund Nasen-Masken angeboten, Arbeitsplätze umgestaltet (Bsp.: Beratungsgespräche hinter Plexiglasscheibe), wo möglich, „Mobile Working“ als Teil der Arbeitskultur und damit einhergehend neue Formen von Dienstbesprechungen/Teamsitzungen und Gremien (z.B. Fachzirkel, Arbeitskreise, Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen etc.) eingeführt sowie neue Formate zum Informationsaustausch gestaltet. Weiterhin haben die Einrichtungen/Organisationen vielfältigste, innovative, digitale, soziale, unkonventionelle und kreative Maßnahmen entwickelt und mit hohem/n Eigenengagement und -mitteln umgesetzt. So fanden beispielsweise Beratungen beim Spazierengehen, am Fenster der Einrichtung bzw. auf der Parkbank statt; Safer-Use-Materialien und Lebensmittel wurden am Fenster, der Tür ausgegeben bzw. geliefert; Masken und andere Schutzausrüstungen wurden im Rahmen von Beschäftigungsangeboten genäht/hergestellt; Kinder aus suchtbelasteten Familien wurden abgeholt und 1:1 betreut (statt in der Gruppe); Sport- und Spaßturniere und andere Outdoor-Angebote/Aktivitäten angeboten; spezielle Angebote für suchtbelastete Familien, Kinder und Jugendliche vorgehalten, wie z.B. Kindergruppen über Messanger-Dienste, UNO-Spielen per Videochat, Talk Runden über Streamingplattformen u.v.m.. Insofern die Voraussetzungen gegeben waren, haben die Einrichtungen/Organisationen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit und/oder als Ausgleich der Defizite finanzielle Unterstützung (vorrangig SodEG und Kurzarbeitergeld) in Anspruch genommen. Knapp 40% haben diese beantragt, bei 15% wurden bereits Mittel bewilligt, bei 7% wurden diese abgelehnt, 8% planen eine Beantragung und knapp 30% nehmen keine Unterstützungsleistungen in Anspruch. Dabei gibt die deutliche Mehrheit der Einrichtungen/Organisationen an, dass entstandene finanzielle Defizite durch die Schutzpakete des Bundes und der Länder nicht kompensiert werden und bereits jetzt oder perspektivisch nicht kompensierte Einnahmenausfälle zu verzeichnen sind. Die Lücken der Schutzpakete werden insbesondere in der Refinanzierung der Schutzkleidung und -ausstattung, und sonstiger Sachmittel (inkl. technischer Ausstattung), der Kompensation der Minderbelegung sowie der Bewältigung des Bürokratieaufwands gesehen. Insbesondere die ARS und die stationären Reha- Maßnahmen in kleineren Einrichtungen bleiben bei den Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von finanzieller Unterstützung bislang unberücksichtigt. Digitalen Angeboten wird bei der Bewältigung der Corona-Pandemie eine besonders hohe Bedeutung beigemessen und dies auf vielfältigsten Ebenen. Diese kann persönliche Kontakte, im kommunikations- und beziehungsintensiven Arbeitsfeld der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe, ergänzen, jedoch
nicht ersetzen. Die Mehrheit der Einrichtungen/Organisationen sieht in der unzureichenden Finanzierungsbasis, den fehlenden digitalen Kompetenzen der Mitarbeitenden und der Klientel, der technischen Kompatibilität mit Kooperationspartner*innen und den juristischen Fragestellungen Hürden für den Einsatz von Technik und Digitalisierung. Deshalb sehen die Einrichtungen/Organisationen vorrangig in der Finanzierung der technischen Ausstattungund in der Beratung zu digitalen Anwendungen weiteren Unterstützungsbedarf, aber auch in der Liquiditätssicherung, Fachkräftegewinnung, Fördermittelberatung und der Beschaffung von Schutzausrüstung/-mitteln.
In einer perspektivischen Einschätzung sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Nachfrage der Angebote im Bereich Suchthilfe und Suchtselbsthilfe für die Mehrheit der Einrichtungen/Angebote nicht absehbar, ein Großteil sieht jedoch einer gesteigerten Nachfrage entgegen. Begründet wird dies mit der Mehrbelastung (psychischen Belastung) der Menschen durch Isolation, Kurzarbeit/Arbeitsplatzverlust, häusliche Konflikte und dem dadurch steigenden Risiko eines erhöhten Suchtmittelkonsums/einer Rückfälligkeit. Im Bereich Suchtprävention wird demgegenüber von einer (kurzfristig) sinkenden Nachfrage ausgegangen, da Schulen/Betriebe, Freizeiteinrichtungen (Clubs/Festivals) voraussichtlich zunächst vorrangigere/ organisatorische Schwierigkeiten bewältigen müssen.
Forderungen des fdr
Zur Bewältigung der Corona-Krise und ihrer sozialen, gesellschaftlichen und finanziellen Folgen werden die Angebote und Leistungen der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe nicht nur dringend gebraucht, sie sind unerlässlich und systemrelevant 2. Denn gerade in unsicheren Zeiten müssen die Menschen sich auf diese sozialraumorientierten, auch institutionellen Unterstützungsangebote3 (mit verstärkten Schutzmaßnahmen) verlassen können, die konstitutiv für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sorgen, zum Gesundheitsschutz und zur Stabilität der sozialen Gemeinschaft beitragen.
Deshalb fordert der fdr:
1. Eine nahtlose Weiterfinanzierung/Förderung aller Angebote der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe.
2. Die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe müssen ihre Arbeit - auch während einer Pandemie - auch im persönlichen Kontakt fortführen können. Dazu benötigen sie zwingend ausreichendes Schutzmaterial und - kleidung, welche sie zentral über die öffentliche Verwaltung beziehen können. Auch ein vereinfachter Zugang zur Coronatestung (auch präventiv) muss über die regionalen Gesundheitsämter geschaffen, sowie die Kostenübernahme sichergestellt werden 4.
3. Die Inanspruchnahme umfassender Präventionsangebote ist vor allem in einer gesundheitsbedrohlichen Situation wie der Corona-Pandemie zu garantieren und Kürzungen auszuschließen. Präventive Maßnahmen bieten die Möglichkeit, kritische Situationen zu bewältigen, persönliche Risikokompetenzen und Schutzfaktoren zu stärken, ein selbstbestimmtes und gesundheitsorientiertes Handeln zu fördern, Substanzgebrauchsstörungen bzw. süchtige Verhaltensweisen zu vermeiden und somit auch steigende Fallzahlen in der Suchthilfe und -behandlung zu verhindern 5.
4. Die ambulante Suchthilfe mit ihren vielfältigen und umfassenden Angeboten für abhängigkeitsgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen und deren Angehörige muss zur Umsetzung ihrer bedarfsgerechten, sozialraum-, teilhabeorientierten und nachhaltig wirksamen Leistungen als Pflichtleistung gesetzlich in der kommunalen Daseinsvor- und fürsorge verankert und folgerichtig verlässlich und leistungsgerecht finanziert werden. Dazu sind verbindliche und unbürokratische Zusagen, in Bezug auf Zuwendungen, Förderungen und Projektmittel, seitens der Kommunen bzw. Leistungsträger notwendig. Da Personal- und Fixkostenzahlungen weiterhin geleistet werden müssen und Rücklagen (aufgrund der Gemeinnützigkeit sozialer Einrichtungen/Vereine) nur begrenzt gebildet werden können, muss die Finanzierung, auch im Falle einer notwendig gewordenen Schließung der Einrichtung, sichergestellt sein.
5. In der Ambulanten Reha Sucht (ARS) ist während einer Pandemie die Grundlage der Finanzierung nicht mehr gegeben. Notwendige Mehraufwendungen zur Umsetzung des Angebotes (Ausstattung, Zeit und Personal) müssen zwingend refinanziert werden. Die bereits zuvor bestehende Unterfinanzierung des Angebotes wird trotz Fortführung (vorrangig im Einzelsetting) und der zu erwartenden Unterstützungsleistungen verstärkt, weshalb eine Ausweitung des Schutzschirmes nach § 111d SGB V auf die ARS sowie die Erfassung von Mehraufwendungen und Erlösausfällen im SodEG notwendig ist. Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung muss die Kompensation der Leistungsausfälle (Regelungen zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz) in Analogie zu bisherigen Unterstützungsleistungen ambulanter Leistungserbringer Berücksichtigung finden.
6. In der stationären Suchthilfe leisten u.a. Rehabilitationskliniken für Abhängigkeitskranke und Entgiftungsstationen - während einer Pandemie - einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz. Die Versorgung der Abhängigkeitskranken muss gerade in dieser Zeit sichergestellt sein, Behandlungen dürfen nicht abgebrochen oder Aufnahmen verhindert werden 6. Um sowohl die Versorgung der Patient* innen sicherzustellen, Schutz- und Hygienemaßnahmen (auch für die Mitarbeiter*innen) umzusetzen 7 als auch einer Gefährdung der Liquidität und damit der drohenden Schließung der Einrichtungen entgegenzuwirken, bedarf es zur Kostenabsicherung gemeinsamer verlässlicher Lösungswege zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern. Der entstehende hohe finanzielle Mehraufwand ist, bspw. durch einen Pandemie-Zuschlag, zu erstatten. Bisherige Schutzschirme (z.B. SodEG) decken weder den Mehraufwand noch Einnahmeausfälle bzw. sind für Rehabilitationskliniken nicht zugänglich.
7. Für Integrationsleistungen von Erwerbsarbeit und ihre stabilisierende, tagesstrukturierende und bedeutende Funktion für suchtgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen haben Träger der Suchthilfe Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt, die sie eigenständig oder in Kooperation mit Bildungs- und Beschäftigungsträgern durchführen. Diese Angebote müssen während und nach einer Pandemie aufrechterhalten werden, um für die Klientel weiterhin u.a. angemessene (Weiter-) Bildungsmöglichkeiten sowie eine bedarfsbezogene Tagesstrukturierung gewährleisten zu können. Da die Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote jedoch meist als Kombination aus unterschiedlichen Fördermitteln und Einnahmen aus den jeweiligen Betriebsstätten vorgehalten werden, greifen die bisherigen öffentlichen finanziellen Unterstützungsleistungen zu kurz und können von den Trägern kaum in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig können gemeinnützige Träger auf keine entsprechenden Rücklagen zurückgreifen. Um ein Überleben der Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Suchthilfe zu gewährleisten, müssen aktuelle Unterstützungsmöglichkeiten auf die komplexen Bedarfe dieser Maßnahmen reagieren und für die betroffenen Träger entsprechend flexibel zu beantragen sein.
8. Die für die Substitution während der Corona-Pandemie getroffenen Regelungen wie z.B. die Take- Home-Verordnung, die Umstellung auf Depotpräparate, die Ausstellung von Z-Rezepten mit Sichtbezug in wohnortnahen Apotheken, die Konsiliararzt-Regelungen, das Aussetzen der Begrenzung der Substitutionsplätze, die Versorgung der Patient*innen durch (ambulante) Pflegedienste, Telemedizinkontakte und die Veränderungen/Verlängerung der Abgabe-und Öffnungszeiten sollten verstetigt werden. Patient* innen, die in (Wohn-) Einrichtungen von staatlich anerkannten Drogenhilfeträgern leben, sollten auch 6 7 weiterhin die Möglichkeit erhalten, von dem dort eingesetzten und dafür ausgebildeten Personal das Substitut zu erhalten. Eine wohnortnahe Versorgung z.B. durch Vergabe des Substituts durch staatlich anerkannte ambulante Drogenhilfeeinrichtungen und erfahrenes und eingewiesenes Personal sowie Apotheken und Hausbesuche (auch im Rahmen einer Notfall-Substitution) wurden erfolgreich erprobt und sollten weiter Anwendung finden können8. Die Versorgung aller Beteiligten mit Schutz- und Hygienematerial stellt dabei eine unverzichtbare Voraussetzung dar.
9. Die Suchtselbsthilfe ist ein wichtiger Bestandteil des Suchthilfesystems und als systemrelevant einzuordnen 9. Für die Mitglieder sind die regelmäßigen Gruppentreffen zum Teil lebensnotwendig, sie geben sich gegenseitig Halt und Unterstützung, verhindern dadurch nicht selten Rückfälle in alte Verhaltensmuster sowie andere persönliche Krisensituationen. Deshalb sollten Suchtselbsthilfe-Gruppen auch in Krisenzeiten ihre Treffen, unter Einhaltung der jeweils notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, durchführen können.
10. Digitale Angebote (Chats, Online-Beratung und –schulung, Videokonferenzen) können die Versorgung der Klient*innen/Patient*innen ergänzend absichern und somit zur Bewältigung einer Pandemie beitragen. Dazu benötigen Organisationen und Einrichtungen der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe eine entsprechende technische Ausstattung sowie eine Beratung zur Anwendung. Die Bereitstellung und Finanzierung muss zwingend kommunal, länderspezifisch bzw. durch den jeweiligen Kostenträger erfolgen. Verschiedene Förderprogramme z.B. zur Prozessdigitalisierung, IT-Sicherheit, Online- Marketing oder Software- und App-Entwicklung wurden bundesweit bereits zur Verfügung gestellt, gemeinnützige Organisationen bleiben aber bislang von diesen Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi], Förderprogramm „go digital“) ausgeschlossen. Dieses Versäumnis muss ebenfalls behoben werden.
11. Während der Pandemie haben sich Gesundheitsfachberufe und „Soziale Arbeit“ als zentrale Bestandteile des Gesundheitssystems herausgestellt, da sie einen systemrelevanten Anteil an Gesundheitsförderung, Prävention, Hilfe, Behandlung, Betreuung und Begleitung leisten. Ihre Arbeit muss entsprechend nicht nur verbal geschätzt, sondern auch angemessen bezahlt werden. Insbesondere im Hinblick auf den Fachkräftemangel muss die Attraktivität der Berufsfelder dringend erhöht werden. Dazu können Förderung von Aus- und Weiterbildungsplätzen und breit angelegte Öffentlichkeitskampagnen ebenso beitragen, wie eine systematische Nachwuchskräfteförderung.
Die Angebote der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe haben ihre Systemrelevanz während der Corona-Pandemie 2020 verdeutlicht. Deshalb ist es jetzt und nach Corona von besonderer Bedeutung, diese Unterstützungsangebote verbindlich zur Verfügung stellen zu können. Dazu muss die aktuell prekäre Finanzierung der Organisationen und Einrichtungen der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe nachhaltig stabilisiert, unterstützt bzw. gefördert werden.
Berlin, 17. Juli 2020
Friederike Neugebauer
Geschäftsführerin
2 DHS (2020): Suchthilfe während und nach der Corona-Krise absichern!
3 SAGE (2020): Stellungnahme zur Corona-Pandemie und ihren Folgen.
4 fdr+ (2020): Stellungnahme zu Notwendigkeiten/Bedarfen der Suchthilfe
5 fdr+ (2020): Stellungnahme zur Aussetzung von Präventionsmitteln
6 Gemeinsame Position der Suchtfachverbände (2020): zum Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen
der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen
7 Gemeinsame Position der Suchtfachverbände (2020): zur Verordnung zu Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
bei Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-COV-2
8 fdr+ (2020): Stellungnahme zur Substitutionsbehandlung während der Corona-Pandemie
9 DHS (2020): Positionierung Suchtselbsthilfe
Deutschland im Corona-Rausch? - Jeder Dritte trinkt mehr
"Schon Anfangs der Coronakrise haben wir darauf hingewiesen, dass sich das Trinkverhalten der Deutschen aufgrund der Herausforderungen die u.a. durch den Lockdown und die damit verbundenen Abstands- und Kontaktregeln entstehen, verändern wird. Ohne "Schwarzmalen" zu wollen, haben wir auf den besonderen Bedarf - auch und gerade in Krisenzeiten - der Präsenzgruppen in der Suchtselbsthilfe hingewiesen, um einem "Abrutschen" in die Sucht, Rückfällen oder steigendem Alkoholmissbrauch vorzubeugen und versucht die maßgebenden Behörden und Ministerien entsprechend zu informieren und zu sensibilisieren. Nicht nur aufgrund unserer täglichen Erfahrungswerte scheint sich diese Befürchtung bestätigt zu haben".
(Blaues Kreuz München e.V., ng)
Das ZI in Mannheim initiiert derzeit eine Umfrage hierzu.
Suchtexperten warnten zu Beginn der Corona-Krise vor steigendem Alkoholmissbrauch: zu Recht, wie erste Zahlen zeigen. - Was kann dagegen getan werden?
Laut einer Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit hat jeder dritte Erwachsene in der Corona-Krise mehr Alkohol getrunken. Die anonyme Umfrage ist nicht repräsentativ.
Ein kaltes Bier, ein Gläschen Wein: In Zeiten von Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und abgesagten Veranstaltungen scheinen sich die Deutschen besonders gerne Alkohol zu gönnen.
Wie eine Studie des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg zeigt, stieg der Alkoholkonsum bei rund einem Drittel der Erwachsenen seit der Corona-Krise. 35,5 Prozent der mehr als 3.000 Teilnehmenden gaben bei der anonymen Online-Umfrage an, während der Covid-19-Pandemie mehr oder viel mehr Alkohol getrunken zu haben als zuvor.
Mehr Anfragen bei Beratungsstellen seit Corona
Unterdessen berichten Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen von deutlich mehr Interessenten: Die Frequenz bei den Anrufen und bei den schriftlichen Anfragen, dem sogenannten Erste-Hilfe-Button, hat deutlich zugenommen. (Peter K., Anonyme Alkoholiker)
"Risikofaktoren für eine Vermehrung des Konsums waren zum Beispiel der Wechsel des Arbeitsstatus, etwa ins Homeoffice, ein hohes gefühltes Stressniveau und Zweifel daran, dass die Krise gut gemanagt wird", sagt Anne Koopmann vom ZI in Mannheim.
Alkohol während Krise: Arme Menschen besonders betroffen
Menschen mit einem hohen Stresslevel und geringerem sozialen Status gaben demnach eher an, in der Krise mehr Alkohol zu trinken. Menschen in systemrelevanten Berufen, die weiter arbeiten konnten, tranken den Angaben zufolge dagegen eher weniger oder behielten ihren Konsum bei.
"Die Corona-Krise ist für viele Menschen auch eine emotionale Krise: Sowohl gesundheitsbezogene als auch finanzielle Sorgen und Ängste sind für viele Menschen sehr präsent. Alkohol ist ein Mechanismus, eine kurzfristige Linderung diese Sorgen zu erleben", erklärte Koopmann. Das könnte auch erklären, warum der Konsum bei Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status ausgeprägter war. "Hier mehren sich die Sorgen und es gibt weniger Kompensationsmöglichkeiten."
Die Nachfrage nach Alkohol ist seit Corona stark gestiegen. Es wird deutlich mehr Alkohol verkauft als zuvor. Gleichzeitig fallen Therapiesitzungen für trockene Alkoholiker wegen Corona aus.
Corona-Krise: Genau auf Suchtverhalten achten
Immer mehr entladen sich diese Konflikte in den Familien und Partnerschaften. Die Corona-Krise habe bereits bestehende Alkoholprobleme sichtbar gemacht: Menschen, die bisher ihr Trinkverhalten verborgen haben - etwa auf dem Weg zur Arbeit, am Arbeitsplatz, in der Kneipe - waren durch Corona gezwungen, zu Hause zu trinken. (Peter K., Anonyme Alkoholiker)
Koopmann betont, dass das Mehr-Trinken über einen längeren Zeitraum das Risiko für eine Abhängigkeit signifikant erhöhe, aber nicht zwangsläufig dazu führen müsse. "Jetzt sind wir in der Situation, dem noch entgegenzuwirken", sagt Koopmann. Jede und jeder könne sein Trinkverhalten genau beobachten, dieses etwa mit Hilfe eines Tagebuchs dokumentieren und sich vielleicht einem Arzt oder einer Beratungsstelle anvertrauen.
Quelle: ZDF
Datum: 06.07.2020 11:16 Uhr
Mehr Information hierzu:
https://www.zi-mannheim.de/institut/news-detail/umfrage-37-prozent-trinken-mehr-alkohol.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/214451/Alkohol-und-Rauchen-Die-COVID-19-Pandemie-als-idealer-Naehrboden-fuer-Suechte
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Factsheet über Alkoholkonsum und COVID-19 veröffentlicht. Wir fassen für Sie zusammen.
Das Wichtigste in Kürze
- Der Konsum von Alkohol schützt nicht vor COVID-19. Unter keinen Umständen sollten Sie Alkohol trinken, um eine Infektion zu verhindern oder zu behandeln.
- Alkoholkonsum schwächt das Immunsystem und verringert somit die Fähigkeit des Körpers, mit Infektionskrankheiten umzugehen.
- Starker Alkoholkonsum erhöht das Risiko eines akuten Atemnotsyndroms (ARDS), einer der schwerwiegendsten Komplikationen von COVID-19.
Mythen über Alkohol und Corona
Mythos: Alkoholkonsum zerstört das Coronavirus.
Fakt: Der Konsum von Alkohol zerstört das Virus nicht, sondern erhöht wahrscheinlich das Gesundheitsrisiko, wenn eine Person mit dem Virus infiziert wird. Alkohol in einer Konzentration von mindestens 60 Vol.-% wirkt als Desinfektionsmittel auf Ihrer Haut, hat jedoch bei Einnahme keine solche Wirkung in Ihrem Körper.
Mythos: Wenn man starken Alkohol trinkt, wird das Virus in der eingeatmeten Luft abgetötet.
Fakt: Alkoholkonsum tötet das Virus in der eingeatmeten Luft nicht ab. Alkohol desinfiziert Ihren Mund oder Hals nicht, und gibt Ihnen keinerlei Schutz gegen COVID-19.
Mythos: Alkohol (Bier, Wein, Spirituosen) stimuliert die Immunität und Resistenz gegen das Virus.
Fakt: Alkohol hat schädliche Auswirkungen auf Ihr Immunsystem und stimuliert nicht die Immunität oder die Virusresistenz.
Aktuelle und verlässliche Informationen zum Coronavirus finden Sie auf www.infektionsschutz.de.
Alkohol und räumliche Distanzierung
Um die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, wurden Ausgangs- und andere Kontaktbeschränkungen eingeführt. Restaurants, Bars, Cafés und Clubs sind deshalb geschlossen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren und gesünder zu leben!
Alkohol: Was ist während der Corona-Pandemie zu tun und was nicht?
- Vermeiden Sie Alkoholkonsum, um Ihre Gesundheit nicht zu gefährden und Ihr Immunsystem nicht zu schwächen.
- Bleiben Sie nüchtern, damit Sie schnell handeln und Entscheidungen mit klarem Kopf für sich und andere in Ihrer Familie und Ihrem Umfeld treffen können.
- Wenn Sie trinken, dann nur wenig. Auf keinen Fall sollten Sie bis zum Rausch trinken.
- Vermeiden Sie Alkohol als Anlass für das Rauchen und umgekehrt: Menschen neigen dazu, mehr zu rauchen, wenn sie Alkohol trinken. Und Rauchen kann zu einem schwereren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung führen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu Alkohol haben, und lassen Sie sie nicht sehen, dass Sie Alkohol konsumieren – seien Sie ein Vorbild.
- Besprechen Sie mit Kindern und Jugendlichen die Probleme, die mit Alkoholkonsum und COVID-19 verbunden sind, wie z. B. Verstöße gegen die Abstandsregeln und die Kontaktvermeidung, die die Pandemie verschlimmern können.
- Konsumieren Sie keinen Alkohol, wenn Sie Medikamente einnehmen. Alkohol kann deren Wirksamkeit beeinträchtigen oder zu gefährlichen Nebenwirkungen führen. Dies gilt vor allem für Medikamente, die auf das Zentralnervensystem wirken, z. B. Schmerzmittel, Schlaftabletten, Antidepressiva.
- Wenn Sie von zuhause aus arbeiten, halten Sie sich an Ihre üblichen Arbeitsplatzregeln und trinken Sie währenddessen keinen Alkohol.
- Alkohol ist kein notwendiger Bestandteil Ihrer Ernährung und sollte auf Ihrer Einkaufsliste keine Priorität haben. Investieren Sie Ihr Geld besser in Lebensmittel, die gesund sind und die Reaktion Ihres Immunsystems verbessern.
- Vermeiden Sie es, Alkohol zuhause aufzubewahren, da dies möglicherweise Ihren Alkoholkonsum und den anderer in Ihrem Haushalt erhöht.
- Alkohol zu trinken, um mit Stress umzugehen, ist kein guter Bewältigungsmechanismus. Denn Alkohol erhöht nachweislich die Symptome von Panik- und Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Störungen sowie das Risiko von familiären Konflikten und häuslicher Gewalt.
- Treiben Sie Sport, anstatt Alkohol zu trinken. Körperliche Aktivität stärkt das Immunsystem und ist sowohl kurzfristig als auch langfristig eine sinnvolle Methode, um die Zeit der Kontaktbeschränkungen zu verbringen.
- Wenn Sie Depressionen oder Selbstmordgedanken haben, ist es sehr wichtig, den Alkoholkonsum zu reduzieren oder ganz einzustellen. Holen Sie sich in diesem Fall telefonisch Hilfe.
- Alkohol ist eng mit Gewalt verbunden, einschließlich Gewalt in der Partnerschaft. Falls Sie Opfer häuslicher Gewalt sind, vertrauen Sie sich Freunden oder Familienmitgliedern an. Organisieren Sie sich einen Zufluchtsort für den Fall, dass die Situation eskaliert. Unterstützung können Sie auch telefonisch von einer Beratungsstelle erhalten.
Alkoholkonsumstörungen und COVID-19
Alkoholkonsumstörungen sind durch hohe Konsummengen und Kontrollverlust über den Alkoholkonsum gekennzeichnet. Starker Alkoholkonsum erhöht das Risiko eines akuten Atemnotsyndroms (ARDS), einer der schwerwiegendsten Komplikationen von COVID-19.
Menschen mit einer Alkoholkonsumstörung haben zudem ein höheres Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, weil sie häufiger von Obdachlosigkeit oder Inhaftierung betroffen sind als andere Mitglieder der Bevölkerung. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es daher wichtig, dass Menschen, die aufgrund ihres Alkoholkonsums Hilfe benötigen, alle Unterstützung erhalten, die sie benötigen.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person Probleme mit dem Alkoholkonsum haben, beachten Sie bitte Folgendes:
- Die gegenwärtige Situation ist eine gute Gelegenheit, mit dem Trinken aufzuhören oder zumindest erheblich zu reduzieren, da verschiedene Anreize und Situationen des Gruppendrucks wie Partys, Treffen mit Freunden, Restaurants- und Clubbesuche nun nicht mehr vorkommen.
- Versuchen Sie, Ihren Tagesablauf so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, sich auf Dinge zu konzentrieren, die Sie kontrollieren können, und versuchen Sie, entspannt zu bleiben – zum Beispiel durch tägliche Bewegung, Hobbys oder Entspannungsübungen.
- Halten Sie die räumliche Distanzierung ein, aber isolieren Sie sich nicht sozial: Rufen Sie Freunde, Kollegen, Nachbarn und Verwandte an oder schreiben Sie ihnen.
- Bitten Sie jemanden, dem Sie vertrauen, Ihnen als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen – entweder persönlich oder am Telefon.
- Holen Sie sich bei Bedarf zusätzliche, auch anonyme, Hilfe, z. B. durch Online-Beratung, Online-Interventionen durch Fachleute, oder Selbsthilfegruppen.
- Desinfektionsalkohol kann in häuslicher Isolation leicht für Konsumzwecke zugänglich werden. Es ist daher wichtig, solche Produkte außerhalb der Reichweite von Personen zu halten, die sie möglicherweise missbrauchen.
- Falls Sie an COVID-19 erkranken, sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder dem Krankenhauspersonal über Ihren Alkoholkonsum, damit Sie die für Sie am besten geeignete Behandlung erhalten.
Quelle
World Health Organization, Alcohol and COVID-19: what you need to know, April 2020